Sexualitäten. Genealogien queerer Theorie
32. Workshop am Institut für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft
07.02.2025 14:15 Uhr – 18:15 Uhr
Organisation: Maciej Bakinowski und Jenny Willner
Freitag, 7. Februar 2025, 14:15–18:15, Raum U104B
- Programm als Download
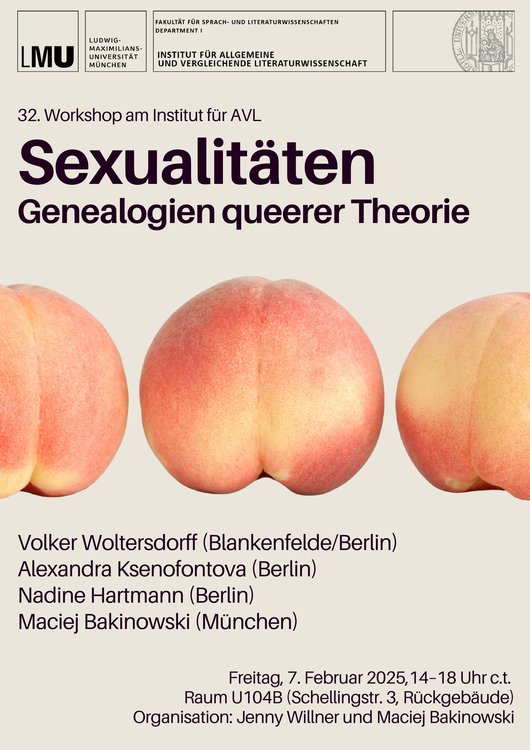
Dieser Institutsworkshop ist aus einem gemeinsam unterrichteten Seminar hervorgegangen, in dem wir zunächst das Verhältnis der Queer Theory zur Begriffsgeschichte von „Perversion“ und „Abirrung“ sowie zum Polymorphen in Freuds Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie (1905) erkundet haben. Ausgehend davon haben wir uns mit den Genealogien von radikalen sexualpolitischen Entwürfen befasst, wie sie in großen Metropolen zwischen aktivistischen und akademischen Milieus entstanden: bei Guy Hocquenghem etwa im Umfeld des Pariser Mai ’68 und unter dem Eindruck von Stonewall ’69, bei Douglas Crimp und Ann Cvetkovich hingegen mitten in der Aids-Krise und den Gründungsjahren von Act Up! New York. Wir haben uns auf Kontroversen, Widersprüche und Verzweigungen konzentriert. Die im Seminar gelesenen Texte kommen vielleicht am ehesten darin überein, dass sie jenseits kapitalistischer Verwertungslogiken operieren und dass sie Sexualität vor allem nicht als eine Essenz fassen, über die wir verfügen können. Im Fokus standen also Ansätze, die sich weit mehr für die Dekonstruktion von Identitäten und Identitätspolitiken interessieren als für eine Konsolidierung oder gar Offenbarung von Identität. Mit der Lektüre von Leo Bersani und Lee Edelman haben wir über queere Negativität gesprochen, also über Versuche, sich gemäß der Perspektive des gesellschaftlich Verdrängten oder Verworfenen zu positionieren: Ansätze, denen zufolge die Tendenz zur Homonormativität nur die Ausweitung einer erdrückenden Norm bewirkt, die immer neue Ausschlüsse produziert.
Seit den ersten auch literaturwissenschaftlichen Artikulationen von queer theory – am Prominentesten durch Eve Kosofsky Sedgwick und Judith Butler – sind nunmehr über drei Jahrzehnte vergangen. Was ist seitdem aus der Resignifizierung des Schrägen, der Abirrungen, des früher pathologisierend für pervers Befundenen geworden?
Mit dem Thema des Workshops navigieren wir auf einem Terrain, auf dem jedes Wort aufgeladen ist. Das Gespräch, das wir führen wollen, wird dadurch nicht erleichtert, dass der affirmative Gebrauch des Wortes „queer“ von der Subkultur in große Bereiche des popkulturellen Mainstream gelangt ist – ein Erfolg, der sich unter anderem darin niederschlägt, dass längst von einem regelrechten Queerbaiting als Vermarktungsstrategie die Rede ist. Die Texte, die wir gelesen haben, stehen insofern quer zu dieser Tendenz, als sie von analytischer Wachsamkeit gegenüber beanspruchter Subversion und tatsächlicher Aneignung geprägt sind: Queere Theorien bilden einen privilegierten Ort der Kritik an den Paradoxien sexueller Liberalisierung. Einerseits ist also das Wort „queer“ etabliert wie nie zuvor. Andererseits – und das ist die dringendere Frage – erleben wir einen Aufschwung rechtspopulistischer bis offen faschistischer Bewegungen, denen zufolge gerade die glitzernde Regenbogenvielfalt, die mit dem Wort „queer“ verbunden ist, als Teil einer Verschwörung der Eliten zu verstehen und mit allen Mitteln zu bekämpfen sei: Die Gender-Ideologie trete „wie der Wolf im Schafspelz“ auf, „harmlos erscheinend und zugleich sehr gefährlich“, es drohe der Zerfall der Gesellschaft etwa durch „Frühsexualisierung“ und „Gender-Wahn“. Hinzu kommt, dass der queeren Bewegung von linker Seite mitunter vorgehalten wird, von den sozialen Kämpfen und von materieller Ausbeutung abzulenken und somit gar Mitschuld am Aufschwung der neuen Rechten zu tragen. Ein Problem, das die neoliberale Gesellschaft insgesamt betrifft, wird in einem Akt der Projektion bevorzugt anhand ihrer queeren Vertreter*innen verhandelt.
Forschend über queere Theorien der Sexualität zu sprechen heißt nicht, in ein Lob queerer Selbstverwirklichung einzustimmen, die auf eine stabile Selbstidentität zuzusteuern glaubt. Es heißt jedoch erst recht nicht: gegen entsprechende Identitätsentwürfe zu wettern, denn damit hält man sich wichtigere Fragen vom Leib. Wir müssen konzentriert und differenziert lesen, Ambivalenzen und auch schmerzhafte Widersprüche aushalten – und genau diese Haltung ist gefährdet. Es ist eine sachliche Feststellung, dass wir mit diesem Workshop einen Raum nutzen, dessen Schließung mit in Aussicht gestellt wird, wenn eine – übrigens betont nicht-queere – Kanzlerkandidatin einer rapide wachsenden deutschen Partei unter raunendem Applaus davon spricht, „alle Gender Studies“ zusammen mit den „Windmühlen der Schande“ abzuschaffen.
Für den Workshop haben wir Vortragende gewinnen können, die sehr genau lesen, ein Gespür für Widersprüche, blinde Flecken oder Tabus mitbringen und uns in ihren Beiträgen zuweilen an die Ränder dessen führen werden, was gemeinhin unter queer verstanden wird. Sie haben die Einladung angenommen, sich wahlweise vertiefend oder ergänzend zu unserem Seminarplan zu verhalten und mit uns zu diskutieren.
Volker Woltersdorff, der seit den 00er Jahren – damals an der AVL, FU Berlin – zu den Pionieren auf dem Gebiet queerer Sexualitätsstudien in Deutschland gehört, widmet seinen Beitrag der Aufarbeitung eines Tabus innerhalb der queer theory: Es handelt sich um die Geschichte der Legitimation sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in queerer Geschichte und Theoriebildung. Sein Vortrag thematisiert die Notwendigkeit ebenso wie die Schwierigkeit einer solchen Aufarbeitung unter den Bedingungen nach wie vor wirksamer homophober Projektion.
Um die antisemitische Rassifizierung von Homosexualität im 19. Jahrhundert, d. h. die Parallelgeschichte von Konstruktionen des ‚jüdischen‘ und des ‚homosexuellen‘ Körpers sowie die Nachwirkungen dieser Diskursformation bis in die Gegenwart, kreist der Beitrag der Komparatistin Alexandra Ksenofontova. Ihr Fokus liegt auf den Romanen Dance on My Grave (1982) von Aidan Chambers und Call Me by Your Name (2007) von André Aciman. Die Verfilmung des letzteren Romans durch Luca Guadagnino (2017) ist auch jenseits akademischer Theoriedebatten für die ‚queere Kultur‘ der jüngeren Generation emblematisch geworden.
Der Begriff der Differenz steht quer zum Begriff queer. Darin besteht ein Grund mehr, ihn zu diskutieren: Ausgehend von der Frage nach Differenz und Differenzen setzt sich die Psychoanalytikerin und Kulturwissenschaftlerin Nadine Hartmann mit Catherine Malabous aktueller Theorieproduktion auseinander, mit Luce Irigaray sowie mit der Frage nach den Verschränkungen von Symbolischem und Biologischem und dem Potenzial eines ontologischen Materialismus. Wie weit kann man mit den Lippen (Irigaray) und mit der Klitoris (Malabou) denken?
Überlegungen zum queertheoretischen Potenzial von Onkel- und Tantenfiguren stehen im Zentrum des Beitrags von Maciej Bakinowski. „Forget the Name of the Father. Think about your uncles and your aunts“, schrieb dereinst Kosofsky Sedgwick. Hiervon ausgehend werden die Seitenverwandtschaften in der Prosa Hervé Guiberts behandelt, die sich – von Suzanne et Louise (1980), einem roman-photo über Guiberts Großtanten, über die berühmte Aids-Trilogie (ab 1990) bis hin zu seinem posthum veröffentlichten Videokrankheitstagebuch La Pudeur ou l’Impudeur (1992) – immer wieder von Tanten heimsuchen lässt.
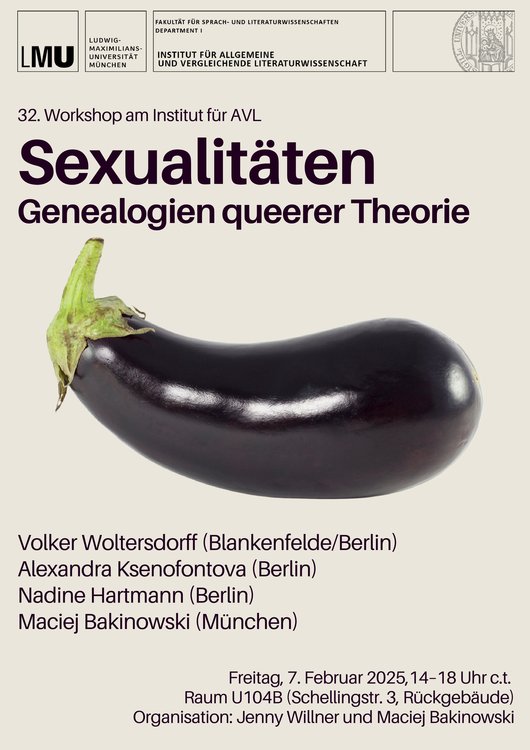
14:00 Ankunft
Teil I: 14:15–16:00
Jenny Willner, Maciej Bakinowski:
Begrüßung
Volker Woltersdorff (Blankenfelde/Berlin):
„Pädo“-Genealogien: Zur Legitimation sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in queerer Geschichte und Theoriebildung
Alexandra Ksenofontova (Berlin):
„Und ich bin nicht nur jüdisch, sondern dazu auch noch schwul.“ Rassifizierung des Homosexuellen als Herausforderung für Queer- und Trans*-Theorien in Europa
Pause: 16:00–16:30
Teil II: 16:30–18:15
Nadine Hartmann (Berlin):
Differenz und Differenzen – wie weit kann man denken mit Lippen und Klitoris?
Maciej Bakinowski (München):
Écritanteure. Seitenketten und Seitenverwandtschaft bei Hervé Guibert
Abschlussdiskussion
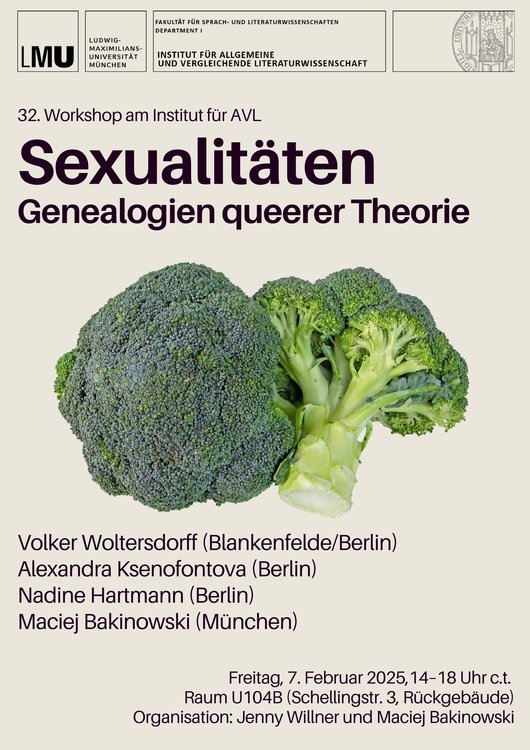
Plakatgestaltung: Maciej Bakinowski

